Rechtschreibfehler vermeiden – im Irrgarten der deutschen Grammatik
New work
30.09.2022

Hamburg, im August 2004. Es ist einer dieser Tage, an denen Bastian Sick einen neuen Beitrag in eine Welt entlässt, die durch orthographische Narrenfreiheit nur so vor Fehleranfälligkeit strotzt. Im Vorwort seiner Publikation „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“ klärt der SPIEGEL-Kolumnist über alte und neue Irrtümer der deutschen Sprache auf, bei denen sich die Lehrbuchseiten heutiger Germanistinnen und Germanisten regelmäßig kräuseln. Immerhin schleichen sich durch Sprachwandelphänomene sowie die neue Rechtschreibreform Unsicherheiten ein, die teilweise zu spektakulären Schreibweisen führen. Dies geht sogar so weit, dass der Autor zu folgender These kommt: Unser rezentes Deutschland sei „ein Jammertal, durch das orientierungslose Wanderer zwischen alter und neuer Orthografie verwirrt umhergeistern“.
Schließlich kennt es jeder von uns vermutlich: diese typischen Begriffe, Phrasen oder Satzstrukturen, bei deren Schreibweise sich zahlreiche Geister der Küchen-Linguistik scheiden. Trotz der Tatsache, dass sich die heutigen Lehrbücher von Normen verabschiedet haben, wie „korrektes Deutsch“ zu lauten hat, existieren auch für heutige Schreibung Konventionen – besonders im regelkonformen Deutschland. Und doch scheint manches heutzutage zusammen zu passen, wo einst niemand auch nur auf die Idee gekommen wäre…
So machen Dinge heutzutage Sinn, anstatt ihn zu ergeben, es wird wild mit Apostrophen um sich geworfen, um Jedermann´s Besitz, Nachbar´s Rasenmäher oder Oma Rosi´s Torte zu adressieren. Menschen sind besser wie jemand, aber nicht mehr als, und es scheint, als befände sich der Genitiv längst auf einem Abstellgleis, welches vom Zuge des Dativs überrollt wird. Unendlich, kontrovers und emotional aufgeladen – die Diskussion um Sprachwandel und korrekte Schreibung bringt so manche Sprachpurist:innen ins Straucheln. Wagen wir aus diesem Grund einen Blick in die diffuse Welt der Rechtschreibung und sehen wir uns an, welche Zweifelsfälle besonders häufig zu beobachten sind.
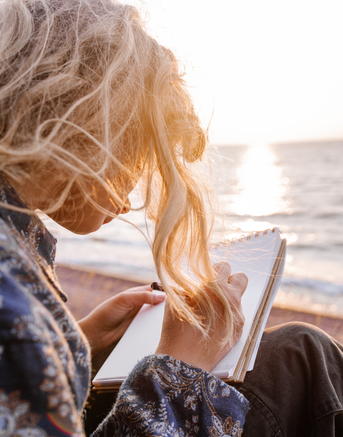
Kreativität gegen Konformität – eine Generation im Interessenskonflikt
Von sechs auf 16: Fakt ist, dass Deutschlands Schüler:innen stetig schlechter schreiben, zumindest so, wie es Duden und Co. recht ist. In einer Studie, durchgeführt von Wolfgang Steinig an der Universität Siegen, verglich der Professor für Germanistik Schulaufsätze der letzten drei Jahrzehnte. Das Ergebnis: wo auf 100 Wörter im Jahr 1992 lediglich sechs Rechtschreibfehler kamen, sind es 2012 ganze 16 Irrtümer. Die Rechtschreibung leide, dafür steige allerdings die Kreativität an – ein Wandel der Gemüter?
Gründe für die zunehmende Verunsicherung sind nicht ausschließlich innerhalb der Kompetenzen von Schreiber:innen zu finden – nein, vielmehr führen verschiedene Faktoren dazu, dass immer häufiger Fehler auftreten und etabliert werden. Diese sind beispielsweise:
- Die Trockenheit der Grammatikwüste. Wie oft hatten Sie bereits eine Deutsche Grammatik in ihren Händen? Vermutlich lediglich dann, wenn wirklich keinerlei Weg daran vorbeiführte und die Zweifel zu groß waren, anstatt dass sie einfach nach bester Intuition umgangen werden könnten. „Größtmögliche Akribie und pädagogischer Eifer, geringstmöglicher Unterhaltungswert“, beschreibt auch Bastian Sick die Grundrezeptur eines traditionellen Nachschlagewerks. Dieses ist sind nicht nur von größtmöglicher Trockenheit, sondern oft auch schwer verständlich für Laien, sodass Fehler oft nur schwer beseitigt werden können.
- „Mit dem Wissen kommt der Zweifel“. Wie bereits Johann Wolfgang von Goethe erkannte, die Unsicherheiten einer Person größer, je mehr diese über einen Sachverhalt weiß. Besonders Schreibberatungsstellen berichten, dass besonders häufig Nachfragen von Menschen eingehen, die viel mit Schriftsprache konfrontiert sind – darunter beispielsweise Redakteur:innen oder Sekretär:innen. Durch Publikationen werden diese dann wiederum weitergetragen werden.
- Die Macht der Zeit. Sprachwandel ist ein Phänomen, welches der Macht der Zeit unterliegt. Wo früher einmal gewisse Schreibweisen oder Begrifflichkeiten als Gebrauchsstandard galten, sind diese heutzutage von aktualisierten ersetzt worden. Auch Schreibungen, die früher einmal nicht legitim oder gebräuchlich waren, beispielsweise Progressivformen wie "ich bin gerade am Arbeiten", können über die Zeit grammatikalisiert werden.
- Die neue deutsche Rechtschreibung. Es ist der 01. August des Jahres 1998, als sich Deutschland, Österreich, die Schweiz, Liechtenstein sowie andere Staaten mit deutschsprachigen Bevölkerungsanteilen dazu entschieden, Vereinfachungen innerhalb der Orthografie vorzunehmen. "Dass" anstelle von "daß", das Verschwinden des Kommas vor "oder", Schifffahrt mit drei "f": für Personen, deren Schulzeit vor 1998 ihr Ende gefunden hat, bedeutet die neue deutsche Rechtschreibung mitunter zusätzliche Verwirrung, schließlich wurden manche Regeln erneuert, ersetzt oder gänzlich umgeworfen.

Grammatikfehler 1: Der „Deppen-Apostroph“ (Bastian Sick)
„Wenn bei Restaurantnamen wie ‘Kathrin's Depot’ ein falscher Apostroph steht - das tut meinem Auge weh“, beschwert sich Uwe Hinrichs, Professor für Südslavische Sprach- und Übersetzungswissenschaft an der Universität Leipzig, im Interview mit der Süddeutschen Zeitung. Und soll damit Recht behalten, zumindest halb. Denn: laut Duden zeigt ein Apostroph an, dass Auslassungen innerhalb eines Wortes getätigt wurden. Wenn Goethe also sagen möchte: „Dass aber der Wein von Ewigkeit sei, daran zweifl’ ich nicht“, so steht das Hochkomma für das apokopierte, also wegfallende „e“ am Wortende. So weit, so gut.
Wenn es sich allerdings um eine Besitzanzeige wie in „Lisas Opel Mocca“ oder „Onkel Gustavs Kaffeetasse“ handelt, dann wird dem Eigennamen lediglich ein „s“ beigefügt – kein Apostroph, keine wilden Grammatikkonstruktionen, bitte. Sollte die Grundform des Namens jedoch bereits auf „s“, „ss“, „ß“, „tz“, „z“, „x“, „ce“ enden, dann und nur dann folgt das Hochkomma.
Grammatikfehler 2: Als und wie, das weiß man nie
„Letztes Wochenende war ich zu Besuch bei meiner Schwester im Saarland. Ich bin älter wie sie und-“ „Das heißt als und nicht wie!“ – Unterbrechungen wie der als-wie-Konflikt sind bereits zu häufig unter feuriger Hitze im verbalen Gefecht ausgetragen worden. Während manche Gemüter wie in sämtlichen Lebenslagen nutzen, sorgen sie bei anderen wiederum für Ärgernis. Dies ist auch kein Wunder, schließlich können beide im selben Kontext verwendet werden, nämlich dem des direkten Vergleichs – deshalb werden sie beide auch als Vergleichspartikeln bezeichnet.
Trotzdem unterscheiden sich als und wie in der Praxis, wodurch so einige Dinner-Debatten zwischen Familienmitgliedern oder Freund:innen entstanden ist. Sehen wir uns aus diesem Grund an, welche Verwendungsweisen beide Wörtchen inhärent sind:
- Als: Ausdruck sprachlicher Ungleichheit; „Ich bin größer als du“. Nach einem Komparativ steht gemäß dem Duden somit immer als, um Unterschiede zwischen zwei Sachverhalten zu verdeutlichen.
- Wie: Ausdruck sprachlicher Gleichheit; „Du bist genauso alt wie ich“. Sind zwei Referenten von gleicher Beschaffenheit, werden sie durch wie miteinander verbunden.

Grammatikfehler 3: Seit der Schule seid ihr gebildet
Achtung, Verwechslungsgefahr! Diese beiden kleinen Wörtchen sehen sich in ihrer Form ziemlich ähnlich, sind jedoch auf funktionaler Ebene grundlegend verschieden. In Zeiten der WhatsApp- und medialen Kommunikation geraten „t“ und „d“ zu einfach durcheinander, schließlich macht es doch wohl kaum einen Unterschied – sie klingen gleich, werden durch dasselbe Phonem abgebildet, wo ist also das Problem?
Ein kurzer Exkurs in die linguistische Morphologie, ergo die Lehre von Wortbildung und Flexion: Das Wörtchen seit gehört zu den Präpositionen, wobei es temporale Bedeutung annimmt, genauer der Angabe des Zeitpunkts, an dem eine andauernde Handlung begonnen hat. Seid mit „d“ wiederum gehört zur Gruppe der Hilfsverben und ist eine flektierte Form von sein in der 2. Person Plural. De facto handelt es sich somit um zwei vollständig verschiedene Begriffe, die jedoch aufgrund ihres Gleichklangs nur zu häufig in Verwechslung geraten.
Grammatikfehler 3: Im Trend der Superlativierung
„Der Film war fantastisch! Am Optimalsten fand ich den Teil, als der Hauptcharakter die idealste Entscheidung überhaupt getroffen und sich für ihre Freunde entschieden hat. Das Allereinzigste, das mich jedoch gestört hat, war dieser eine Nebencharakter…“
Optimalste, idealste, allereinzigste – der Hang zu Superlativen scheint sich besonders durch den zunehmenden Konsum von Werbesprache eingeschlichen zu haben. Dabei scheinen wir jedoch zu vergessen, dass optimal, ideal und einzig bereits in ihrer Semantik das Ideal sind – mehr geht schlichtweg nicht. Und trotzdem steigern wir, wo wir können und das ganz in der Bemühung, stets noch einen drauf zu setzen.
Auch die Tendenz, Verben anstelle von Adjektiven zu steigern, scheint stetig zuzunehmen – so wird aus dem am meisten gelesenen Buch flugs das non-existente meist gelesenste Buch. Vielleicht ist es längst an der Zeit, nicht nur zugunsten von uns selbst, sondern auch unserer Sprache zuliebe wieder auf den gesitteten Boden der Tatsachen zurückzukehren – oder sollte es heißen: auf den meist gesittetsten Boden?
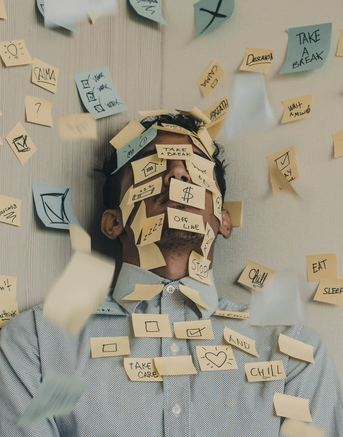
Grammatikfehler 4: „Der Dativ ist dem Genitiv sein Tod“
Früher war alles besser, so schimpft es sich neben dem Volksmund auch oftmals innerhalb der Sprachwissenschaft. Obiger Titel von Bastian Sicks gleichnamiger Publikation sagt und kritisiert es schon in stilistisch-kreativer Weise: der moderne Genitiv schwindet, und das in rasantem Eiltempo auf der Überholspur unserer Standardsprache.
„Wegen dem Arbeiten konnte ich nicht zur Feier kommen, die im Haus vom Nachbarn anlässlich von seinem Geburtstag stattgefunden hat“ – Fakt ist, dass die Ökonomietendenzen unserer Alltagssprache auch vor unseren vier Fällen keinen Halt machen. „Gesperrt wegen Hochwasser“, heißt es auch in schriftlicher auf Straßenschildern nach Regenfällen, dabei war es offenbar neben Dachziegeln, Bäumen und Autos auch der obligatorische Genitiv, den die Flut fortgeschwemmt hatte. Daher ein kurzer Appell an alle Sprachliebhaber:innen dort draußen: lasst uns nicht vollständig durch den vierten Fall in die Irre führen!
Grammatikfehler 5: Zusammen- vs. Getrenntschreibung
„Der Angeklagte rechtswidrigen Rasens auf der A24 ist nun zu Recht/zurecht verurteilt worden, nachdem er sich tagsüber/Tags über törichterweise/ törichter Weise dazu entschieden hat, großspurig/groß spurig zu überholen“ – na, geraten Sie bei der Auswahl an Antwortmöglichkeiten auch manchmal ins Straucheln? Keine Sorge, damit sind Sie nicht allein, schließlich existiert eine Reihe an Regeln, welche die Getrennt- oder Zusammenschreibung von Begriffen beschreiben. Um diese beliebte Fehlerquelle bestmöglich zu vermeiden, lohnt sich hier der Blick in eine Grammatik oder ein Wörterbuch Ihrer Wahl, um individuellen Fällen auf den Zahn zu fühlen. Wie Sie sprachlichen Zweifelsfällen und Missgeschicken bestmöglich begegnen, zeigen wir Ihnen im nächsten Kapitel.
Erste Hilfe gegen Rechtschreibfehler und sprachliche Unsicherheiten

- Studieren über probieren. Wen die Unsicherheit umhertreibt, der sollte sich ab und zu getrost ein Wörterbuch oder eine Grammatik des Deutschen schnappen. Ob Duden oder Langenscheidt, ein Blick in die Theorie kann der Praxis zum zuverlässigen Freund und Helfer werden.
- Die Wunderwelt der Technik. Nahezu sämtliche Schreibanwendungen in der digitalen Welt sind heutzutage mit einer Rechtschreibprüfung ausgestattet – so werden zwar nicht sämtliche Fehler oder inhaltliche Unstimmigkeiten behoben, allerdings können Tippfehler flugs identifiziert werden. So können Sie Ihre Texte direkt im Schreibprozess auf erste Patzer prüfen und ersparen sich die Zeit lästigen Suchens.
- Lesen Sie sich Ihren selbst Text vor. Dieser Tipp mag zunächst banal, wenn nicht sogar albern klingen, schließlich sind die meisten Personen durchaus dazu in der Lage, längere Texte im Stillen zu scannen. Sinn und Zweck dieser Übung ist es aber, nicht nur einen, sondern gleich zwei Sinneskanäle zu beanspruchen, um mögliche Unstimmigkeiten sofort zu entlarven!
- Selbstreflexion zur Fehleridentifikation. Bevor man sich mit Wegen beschäftigt, ein Problem anzugehen, ist es ratsam, sich zunächst über das Problem per se im Klaren zu werden – schließlich kann der korrekte Pfad meist erst dann entdeckt werden, wenn das Ziel klar in Sicht liegt. Rechtschreibtests im Internet können dabei helfen, Ihre Defizite zu filtern und Ihren Fokus anschließend auf diese zu legen. So wird es Ihnen bei der Textgenese leichter fallen, Ihre Achillesfersen zu entdecken und hier besondere Acht auf korrekte Schreibung zu geben.
- Fleiß als Fehlerfresser. Erinnern Sie sich noch daran, wie Sie in der Schule Diktate, Tests und Übungsblätter gepaukt haben? Retrospektiv mag Ihnen dies nervig erscheinen, allerdings hilft regelmäßiges Üben auch als Erwachsener dabei, die eigenen Rechtschreibskills zu trainieren.
- Lesen bildet. Bereits von Kindesbeinen an haben wir erfahren, dass das Lernen von anderen obligatorisch, unverzichtbar ist für den eigenen Wissenszuwachs. Und dies gilt selbstredend in sämtlichen Lebensbereichen – so auch innerhalb der Orthografie. Wer seine Grammatik und Ausdrucksweisen aktiv aufbessern möchte, der ist mit einem guten Buch des Lieblingsautors, dem neuesten Zeitungsartikel oder auch einer wissenschaftlichen Publikation hervorragend bedient. Notieren Sie sich neue Begriffe, um sie fortlaufend in Ihren Wortschatz zu integrieren, unterstreichen Sie wichtige Passagen und achten Sie darauf, aktuelle Literatur zu konsumieren, in der die neueste Rechtschreibung verwendet wird.
- Korrekturlesen gegen unangenehme Überraschungen. Im redaktionellen Tätigkeitsbereich wird häufig vom Begriff des „Redigierens“ gesprochen, welcher als Voraussetzung für Veröffentlichungen gilt, denn: ohne ihn geht, salopp formuliert, gar nichts. Vor Publikation eines Beitrags ist eine finale Bearbeitung notwendig, bei der sowohl orthografische als auch inhaltliche Missgeschicke korrigiert werden. Bestenfalls sollten Sie beim Redigieren Ihres Textes auf mehrere Korrekturrunden setzen, zwischen denen Sie Pausen setzen, um wieder frisch und konzentriert ans Werk gehen zu können.
- Rückwärtslesen. Klingt zunächst verrückt? Ist es tatsächlich gar nicht, denn: „Das Gehirn nimmt die einzelnen Buchstaben mit ihren Merkmalen aber auch nicht ganz genau in der Reihenfolge auf, wie sie geschrieben stehen“, schreibt Karina Hermann im linguistischen Blog Satzzeichen! der Ruhr Universität Bochum (RUB). „Stattdessen werden alle Buchstaben eines Wortes auf einmal aufgenommen, das Wort also als Ganzes erfasst. Daher fällt es uns oftmals auch gar nicht sofort auf, wenn ein Wort falsch geschrieben ist oder ein Buchstabe fehlt.“ Lösen wir die Begriffe aber aus ihrem syntagmatischen Kontext, indem wir sie Wort für Wort konzentriert erfassen, springen uns Fehler direkter ins Auge.
Auf der Suche nach einem neuen Job?
Starte deine Jobsuche hier